 |

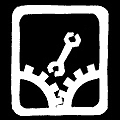 |
 |
 |
Weitere
Fragen politischer Praxis
autonome a.f.r.i.k.a.-gruppe  1993
1993
Medien-Randale (II)
Dieser Text wurde 1993 in verschiedenen linken Zeitschriften veröffentlicht.
Der Bundesanwaltschaft diente er 1995 unter anderem als Vorwand, gegen die Zeitschrift
„radikal“ vorzugehen. Medienrandale II von der autonomen a.f.r.i.k.a.-gruppe
stellt das Bild vom militanten Autonomen in Frage und fordert einen intelligenteren
Umgang mit den Medien ein. Interessant ist auch die Geschichte dieses Beitrags:
Mit der Veröffentlichung dieses Artikels in der radikal wurde u. a. die Verfolgung
angeblicher radikal-MacherInnen begründet. In dem Zusammenhang wird von der Bundesanwaltschaft
in diesem Artikel eine Werbung für die RAF gesehen. Auf die Verbreitung des Textes
im CL-Netz oder in der etablierteren links wurde dagegen überhaupt nicht reagiert.
Es geht um das Ausmaß der Unfähigkeit auf Seiten der Linken, sich den
wahren Problemen der Strategie und Taktik eines massenhaft geführten antirassistischen
Kampfes zu stellen und sie konstruktiv durchzudiskutieren. Um ehrlich zu sein,
unser gemeinsames Wissen reicht nicht aus, um die Rückseite einer Briefmarke
zu füllen. Und dennoch tun wir in unseren Diskussionen über taktische
Fragen und in unseren politischen Einschätzungen weiterhin so, als seien
die Antworten bereis komplett in einer Art Neuausgabe von Lenins „Was Tun?“
niedergelegt. Wie ich sehe, ahnen wir erst, wie ein massenfähiger antirassistischer
Kampf zu führen wäre oder wie der Zug des rassistischen Alltagsbewusstseins,
der heute das Denken der Massen beherrscht, umzuleiten wäre. Diese Lektion
sollten wir besser ziemlich schnell lernen. (Stuart Hall)
Ausgangspunkt unserer Beschäftigung mit der bürgerlichen Medienrandale
waren die autonomen Störaktionen der Weizsäcker- und Heuchlerdemo am
8. November 1992. Abgesehen von einer Analyse, mit welchen ‚journalistischen
Mitteln‘ die bürgerlichen MedienmacherInnen zwischen den Spalten und
über die Frequenzen randalieren, ging es in ‚Medienrandale (I)‘
bereits um die Schwierigkeiten der Vermittlung von Inhalten autonomer Politik
unter den gegenwärtigen politischen Kräfteverhältnissen und unter
der Voraussetzung einer auf fast allen Ebenen bürgerlicher Gesellschaft vorhandenen
Hegemonie rassistischer Diskurse. Schon dort stand auch die Frage an, welche Voraussetzungen
der eigenen Theorie und Praxis zu der diskursiven Niederlage nicht nur in der
rassistischen Asyldebatte geführt haben.
Der nun vorliegende zweite Teil unserer Überlegungen legt das Gewicht noch
mehr auf die aktuellen Probleme der Inhalte und Formen linksradikaler Praxis in
der Bundesrepublik. Im folgenden erscheint es uns wichtig, jene Tendenzen zu problematisieren,
die über kurz oder lang den politischen Bankrott bedeuten könnten. Nach
dem Motto ‚Die Autonomen machen keinen Fehler – sie sind der Fehler‘
(Heinz Schenk) käme es dann nur noch darauf an, sich von bzw. aus ihnen zu
verabschieden. ‚Medienrandale (II)‘ ist aber kein ‚Abschied‘,
sondern ein Versuch, das autonome Agieren selbstkritisch zu untersuchen, bestimmte
Mythen zu hinterfragen und die sich daraus abzeichnenden Konsequenzen für
ein linksradikales politisches Projekt herauszuarbeiten. Wir wollen im Folgenden
anhand einiger Beispiele die gegenwärtige Krise des autonomen Antifaschismus
diskutieren.
Nach den Morden in Mölln hieß es in Stuttgart, nun habe die Auseinandersetzung
mit den Faschisten eine neue Qualität erreicht, es müssten verstärkt
Fascho-‚Zusammenhänge‘ wie die ‚Kolbstube‘ angegriffen
werden. Diese Position vertraten einige autonome GenossInnen und forderten, dass
es möglich sein müsse, die ‚Kolbstube‘ aus einer Protestdemonstration
heraus anzugreifen. Das Vorbereitungsplenum sah sich aber nicht in der Lage, einen
solchen weitreichenden Beschluss für nicht anwesende Demonstranten zu treffen.
So wurde für die Demo „Kein Vertrauen in den Staat! Bekämpfen
wir die faschistischen Organisationen!“ am 28. November vereinbart, aus
dem Zug heraus keine Aktionen gegen das Fascho-Lokal zu unternehmen. Die Diskussionen
um das Vorgehen sowie der Aufruf („Militante Aktionen gegen Strukturen der
Faschisten vorbereiten“) riefen die lokalen Zeitungen schon im Vorfeld auf
den Plan (Stuttgarter Nachrichten: „‚Autonome‘ rüsten gegen
‚Faschos‘“). Da Militanz angesagt war und offenbar der Schaukampf
‚rinks‘ gegen ‚lechts‘ unmittelbar bevorstand, zeigten
auf einmal auch die bürgerlichen Medien ‚Interesse‘ am antifaschistischen
Kampf. Welche Erlösung, nach dem monatelangen rechten Terror endlich wieder
einmal auf das gewohnte Feindbild zurückgreifen zu können. Die bewaffnete
Staatsgewalt versuchte während der Demonstration durch massenhafte Präsenz,
Spaliere, Schlagstöcke und mit Pferden zu provozieren. Alles vergebens. Die
TeilnehmerInnen ließen sich nicht auf das offensichtliche Spiel ein, das
da inszeniert werden sollte. Demgegenüber gelang es in einigen Redebeiträgen
und vor den Augen zahlreicher PassantInnen eine inhaltlich klare und gute Zwischenkundgebung
durchzuführen. Angesichts des martialischen Polizeiaufgebotes im Rücken
der Demonstration wurde auch für Unbeteiligte deutlich, dass die bewaffnete
Staatsgewalt sich allemal lieber mit Linken prügelt, als die Mordtaten der
Rechten zu verhindern.
Doch zwei Stunden nach dem Ende der Demonstration machten sich 47 Leute auf den
Weg zu dem Fascholokal, das schon unter der Woche zweimal angegriffen worden war.
Trotz allem, was sich im Vorfeld ereignete, hielten sie es für angesagt,
den abgeblasenen Angriff dennoch zu starten. Dabei sind sie den Bullen in die
Falle gegangen. 22 Verhaftungen sind das jämmerliche Ergebnis der Dummheit,
an einem solchen Tag unbedingt ‚militant‘ agieren zu wollen. Die Initiatoren
meinten, sie hätten nicht warten können, weil „wir so oft nicht
so viele sind, um eine solche Aktion wagen zu können“. Auf die Vorhaltung,
dass beschlossen war, an diesem Tage derlei besser bleiben zu lassen, hörten
wir nur: „Was geh’n uns die Beschlüsse von so’nem Scheißpazifistenplenum
an – wir machen das, was wir für richtig halten“.
Darüber hinaus vermochten nun die Medien aber wieder vom Inhalt der Demo
abzulenken und berichteten hauptsächlich über die gescheiterte Aktion:
„Samstagmittag nach einer Demonstration linker Gruppen gegen Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit: 22 Personen nach Steinwürfen festgenommen. Angriff
auf ein Lokal rechter Szene verhindert – Gewahrsam bis zum frühen Morgen“
(Stuttgarter Zeitung, 30. November 1992).
Wir stellen dieses Beispiel deshalb an den Anfang, weil sich daran mehrere Probleme
militanter linker Praxis kaleidoskopartig entfalten lassen. Zunächst die
Frage nach dem Interesse der Medien an ‚den Autonomen‘, dann die Frage
nach der Problematik von Militanz und voluntaristischem Subjektivismus angesichts
einer stärker werdenden rechten Jugendkultur sowie schließlich die
Notwendigkeit, sich dazu praktisch wie inhaltlich zu verhalten.
I Die Autonomen – ein
Medienclip?
Obwohl keiNe AutonomeR zu sagen vermag, was ‚die Autonomen‘ sind,
ist diese Spezies in den Medien sehr viel wahrnehmbarer geblieben als jede andere
linke Richtung. Warum? Haben sie ein politisches Patentrezept gefunden, das sie
nach 1989 dazu befähigte zu überleben? Waren es ihre politischen Inhalte
oder sind sie deshalb, weil sie nicht nur Debattierzirkel und Resolutionsmaschinerien
darstellten, sondern immer auch jugendkulturelle Bedürfnisse befriedigten,
attraktiv geblieben? Zynischerweise ließe sich antworten: Gerade weil ‚die
Autonomen‘ inhaltlich am diffusesten von allen linken Gruppierungen und
Richtungen ausfielen, machte ihnen der Zusammenbruch der Gesellschaften sowjetischen
Typs am wenigsten zu schaffen.
Doch das Interesse der Medien an ‚den Autonomen‘ hat sehr viel mehr
mit der Verfasstheit der Medien denn mit der realen politischen Bedeutung autonomer
Politik zu tun. Bürgerliche Medien sind ereignisfixiert, der Fetisch ‚Ereignis‘
konstituiert ihr Interesse an den autonomen Aktionen. Für die inhaltlichen
Anliegen linker und autonomer Politik ist in diesen Medien kein Platz, wohl aber
für die Formen militanter Folklore. Und mit ‚den Autonomen‘ haben
sie eine politische Richtung gefunden, die sich selbst nur allzu gern symbolisch-visuell
konstruiert und stilisiert. Von dem jeweiligen Selbstverständnis profitieren
beide. Für ‚die Autonomen‘ lässt sich gar vermuten: Ohne
derartige Medien würden sie in dieser Form nicht (mehr) existieren. Die Attraktivität
der Autonomen ist nicht zuletzt das Ergebnis eines Mediendiskurses, der sie zu
jenen entschlossenen militanten Kämpfern in schwarz stilisiert und die symbolische
Repräsentanz mit Lederjacke, Stein und Molli immer mehr und immer von neuem
zum unhinterfragten Selbstbild zahlreicher (männlicher) junger Aktivisten
werden lässt.
Wenn dieses medial konstruierte Fremdbild unverdrossen als Selbstbild gepflegt
wird, besteht permanent die Gefahr, dass Militanz immer mehr zu einem Inhalt gerät
und immer weniger ein Mittel ist, das es von Fall zu Fall abzuwägen gilt.
Als Erfolg autonomer Politik wird dann allzu oft die Durchsetzung der Form anstatt
der Verbreitung zu vermittelnder Inhalte angesehen. Typisch ist in diesem Zusammenhang
vielleicht auch die Tatsache, dass vielen Leuten während der Diskussionen
zur Vorbereitung der bundesweiten Aktionstage gegen Rassismus in den Medien zu
‚Medienrandale‘ nur die Assoziation ‚Randale gegen die Medien
(finden wir gut)‘ in den Kopf kam, nicht aber dass auch so etwas gemeint
sein könnte wie ‚die Medien randalieren‘, oder gar ‚Randale
für die Medien‘.
Streitpunkt in Bündnisverhandlungen war und ist denn auch meist die Militanzfrage,
die allzu oft zum wesentlichen Knackpunkt gerät bzw. stilisiert worden ist.
Militanz wird mit Entschlossenheit gleichgesetzt, und wer nicht mitzieht, ist
bestenfalls Pazifist oder schlimmer noch ein bürgerlicher Reformist. Diese
Militanz erwuchs im Laufe der 80er Jahre zusehends zu jenem Identitätsfokus,
der dafür sorgte, dass häufig schon allein das Werfen eines Pflastersteines
für revolutionäre Politik gehalten wird. Der politische Erfolg einer
medialen Berichterstattung, die erst jene Aura von ‚Freiheit und Abenteuer‘
ermöglicht, liegt nicht zuletzt darin, dass sie nicht nur im hegemonialen
Mediendiskurs sondern vielfach auch in den Köpfen der Akteure die Form von
den Inhalten abgetrennt hat.
II Ambivalenz der Jugendkultur:
„The Kids are not alright“
Nun war es in der Vergangenheit wenigstens so, dass eine bestimmte Form (Militanz)
einer bestimmten inhaltlichen Orientierung (‚Links‘ – was auch
immer das sein mochte) eindeutig zuordenbar war. Die Autonomen besaßen immerhin
eine Art von Aktionsmonopol, auch wenn die (bürgerlichen) Medien über
deren Deutungsmonopol verfügten. Inzwischen ist aber auch hier einiges in
Bewegung geraten. Es gibt keine Selbstverständlichkeit mehr, mit der sich
rebellierende Jugendkultur als links, als ‚alright’, bewerten lässt.
Aktionen mit Steinen und Molotowcocktails sowie Auseinandersetzungen mit der bewaffneten
Staatsgewalt zeichnen nunmehr auch die rassistischen Pogrome gegen Flüchtlinge
aus. Die Symbolik militanter Aktionen ist verwechselbar geworden (Vgl. D. Diederichsen),
die Unterschiede zwischen ‚Autonomen‘ und ‚Faschos‘ sind
von außen, im Medienbild, allzu häufig nur noch an der Farbe der Schnürsenkel
erkennbar. Die unangenehme Frage, welche Folgen sich aus der Existenz einer rechten
‘Jugendkultur‘ für ein in erster Linie subkulturelles Selbstverständnis
der Autonomen mit seiner Tendenz zur Selbstmarginalisierung ergeben, wenn es vom
Zentrum aus gesehen noch einen anderen ‚Rand‘ der Gesellschaft gibt,
ist übrigens noch kaum diskutiert worden. Wir sehen momentan die Notwendigkeit,
dass das politische Projekt einer autonomen und radikalen Linken nicht mehr in
erster Linie über eine bestimmte Form (‚Militanz‘) bestimmt werden
darf. Es geht nicht mehr an, dass jeder, der gerade lustig ist und irgendwo ‚bauchmäßig‘
einen Stein werfen möchte, damit rechnen kann, von FreundInnen wie politischen
GegnerInnen (insbesondere den bürgerlichen Medien) für einen Vertreter
der Spezies der Autonomen gehalten zu werden.
„Aber es gibt die inhaltliche Differenz“. Natürlich: es
ist nicht dasselbe, wenn Wohlstandschauvinisten Pogrome gegen Flüchtlinge
veranstalten, diese verfolgen und ermorden, und wenn Linke dagegen militant vorgehen.
Aber: es wird zunehmend schwierig, diesen Unterschied ums Ganze auch nach außen
zu vermitteln.
Die bisherige Praxis erweist sich in dieser Frage als wenig hilfreich. Weder demonstrativ
zur Schau gestellte Militanz noch die anderen Symboliken autonomer Selbststilisierung
tragen jedenfalls dazu bei, dieses Problem zu lösen. Inhaltliche Differenzen
lassen sich nicht über folkloristische Aspekte des eigenen Aussehens klarmachen.
Besonders aufgefallen ist uns das in dem merkwürdigen ‚Internationalistischen
Block‘ der Demonstration in Bonn am 14. November 1992 anlässlich des
SPD-Sonderparteitages zur Abschaffung des Asylrechtes. Wenn der einzige Inhalt
einer Manifestation darin besteht, wie gefährlich wir aussehen, dann brauchen
wir keine eigene Abschlusskundgebung. Bereits im Demozug mutierte die Folklore
autonomer Trachten zum Ersatz für fehlende Inhalte. Nicht nur die Sprüche
waren daneben oder extrem verkürzend: „Hinter dem Faschismus steht
das Kapital – Der Kampf um Befreiung ist international“ (Schön
wär’s, wenn es ganz so einfach wäre) oder „Nie, nie, nie
wieder Deutschland!“ Am Ende blieb im Demozug und auf der RednerInnentribüne
nur noch die geheiligte „Internationale Solidarität“ übrig.
Um sich gegenseitig zu zeigen, dass wir auch ganz schön viele sein können,
mögen solche Veranstaltungen ab und an taugen. Sie sagen aber momentan dennoch
mehr über unsere Schwäche als über unsere Interventionsmöglichkeiten
aus.
Um es klarzustellen: Autonome Formen politischer Praxis waren nie nur (aber immer
auch) Medienclip. Die militante Infragestellung der herrschenden Verhältnisse
muss aber auch nach außen rüberkommen. Alles andere ist unpolitisch
oder verkommt zu einem voluntaristischen Subjektivismus, der inhaltlich nur noch
schwer von irgendwelchen Esoterikzirkeln zu unterscheiden ist. Autonome Militanz
droht dann zu einem weiteren belanglosen Spielchen im postmodernen Disneyland
der Metropolen zu verkommen. Welche Möglichkeiten bestehen könnten zu
verhindern, dass dies eintritt, soll im folgenden thematisiert werden. Dazu versuchen
wir zunächst, am Beispiel des Umgangs linker/autonomer Politik mit dem derzeit
in der Bundesrepublik hegemonialen Rassismus einige der inhaltlichen Defizite
aufzuarbeiten.
III Defizite linker/autonomer
Theorie und Praxis
Eine wesentliche Ursache dafür, dass die Linke dem derzeit in der Bundesrepublik
hegemonialen Rassismus so wenig entgegenzusetzen hat, liegt aus unserer Sicht
darin, dass sich linker Antifaschismus bzw. Anti-Rassismus weitgehend auf die
klassischen neonazistischen bzw. offen rassistischen Gruppierungen bezog und ausschließlich
auf diese reagierte. Dabei wurde der stillschweigende rassistische Grundkonsens
im Zentrum der Gesellschaft, der von den gesellschaftlichen Eliten (Bürgermeister-Mob,
Medien, etc.) ständig produziert und reproduziert wird, aus dem Blickfeld
der Auseinandersetzung ausgeblendet.
So haben heute nicht wenige AntifaschistInnen Schwierigkeiten, die neue Qualität
von Morden wie in Mölln und Solingen zu begreifen. Immer noch suchen sie
partout nach jenen streng durchhierarchisierten Faschogruppen, die einfach hinter
dieser Mordbrennerei stecken müssen. Dass dieser Flächenbrand rassistischer
Angriffe nur der extremste Ausdruck des gesellschaftlichen Alltagsrassismus sein
könnte und sich nur dadurch bekämpfen lässt, dass derselbe in der
politischen Auseinandersetzung zurückgedrängt wird, passt natürlich
nicht in eine Denkweise, die solche Anschläge hauptsächlich als gesteuertes
und zentral vorbereitetes neofaschistisches Agieren begreifen will.
Wir behaupten: Diese verkürzte Sichtweise hat Methode und hängt eng
mit dem oben skizzierten, verkürzten Militanzverständnis zusammen. Um
das autonome Militanzkonzept legitimieren zu können, bedarf es der Fixierung
auf ‚Faschisten’. Und Faschisten sind sie alle, gegen die man(n) militant
vorgeht: die Skins, die Bullen, das KaDeWe.
Gleichzeitig werden Rassismus und Faschismus in eins gesetzt: Man geht stellvertretend
gegen die Faschos vor und meint, damit die herrschenden rassistischen Verhältnisse,
die schlicht als faschistisch (v)erklärt werden, anzugreifen. Derlei macht
freilich nur Sinn, wenn innere Widersprüchlichkeiten dieser Verhältnisse
konsequent außer Acht gelassen werden. „Hinter dem Faschismus steht
das Kapital“ und damit Punktum. Dass die Sache so einfach nicht sein könnte
(und wohl noch nie war), wird nicht in Betracht gezogen. Die linke und insbesondere
‘autonome‘ Denkfaulheit, die alles und jedes ständig auf den
falschen Faschismusbegriff bringt, wirkt sich in der gegenwärtigen Situation
in mehrfacher Hinsicht verheerend aus. Eine Denkhaltung, die Angriffe auf die
herrschenden Verhältnisse offensichtlich nur aus deren angeblich faschistischem
Charakter heraus begründen kann, trägt paradoxerweise gerade zur Stärkung
und Legitimation dieser Verhältnisse bei. Indem wir ihnen etwas vorwerfen,
was gegenwärtig gar nicht auf der Tagesordnung steht, vertreten wir eine
diskursiv nicht mehr vermittelbare Position. Eine solche Kritik bewirkt praktisch
eine Verharmlosung der ‚Normalität‘ der kapitalistisch-imperialistischen
Gesellschaftsverfassung. In ihrer Fixierung auf Faschostrukturen vollzieht die
autonome Linke genau jene Einschränkung des Blicks auf den Rand der Gesellschaft,
mit der sie letztlich in einer Reihe mit den Lichterkettendemonstranten steht.
Auch wenn die Begründungen und die Mittel der Auseinandersetzung noch so
unterschiedlich sein mögen: Letzten Endes unterstützt eine solche Fixierung
den herrschenden Diskurs in seiner Tendenz, Rassismus aus dem Zentrum der Gesellschaft
heraus und zum Randgruppenproblem umzudefinieren, anstatt dazu beizutragen, den
Rassismus im Zentrum der Gesellschaft zu thematisieren. Zwar ist klar, dass den
Faschos nicht freie Hand gelassen werden darf. Solange aber der rassistische Grundkonsens
in der Gesellschaft nicht zurückgedrängt wird, werden wir die Auseinandersetzung
auf der Straße nicht gewinnen können.
Dazu kommt ein Problem auf der Ebene militanter Intervention. Es ist einfacher,
eine Kneipe der Nazis anzugreifen, als eine politische Praxis gegen die Produktion
rassistischer Diskurse zu finden. Die eingespielten militanten Aktionsformen greifen
in diesem Bereich nicht und der typisch militante Blick auf die Gesellschaft trägt
auch nicht viel dazu bei, eine andere und wirkungsvolle Praxisformen zu entwickeln.
Diese Schwierigkeiten verweisen auf ein Grundproblem: Ausgangspunkt politischer
Praxis war und ist bisher häufig eine Denkhaltung, die die bürgerliche
Gesellschaft im Grunde als monolithischen und widerspruchsfreien Block auffasst.
Eine solche Analyse lässt letztlich nur die Alternative ‚Alles oder
Nichts‘. Auf der Ebene der Aktionen mündet eine solche Einstellung
allenfalls in eine subjektivistische ‚Angriffs‘-Haltung, auf der Ebene
der Aktionsinhalte bleibt oft genug nur die gebetsmühlenhafte Beschwörung
‚gegen Rassismus, Sexismus, Faschismus, ...‘
Dabei ergibt sich ein fatales Dilemma. Einerseits führt die ‚Übermächtigkeit‘
des Gegners dazu, dass die eigenen Aktionsformen notwendigerweise symbolischen
Charakter haben. Die Wirksamkeit einer solchen Aktion bemisst sich wesentlich
an dem Echo, das sie im bürgerlichmedialen Umfeld auslöst. Zugleich
aber besteht keinerlei Verantwortung für die Art und Weise, in der sich diese
Aktionen im medialen und gesellschaftlichen Diskurs auswirken. Die als einheitlicher
Block gedachte bürgerliche Presse schreibt ja ohnehin, was sie will bzw.
was den Interessen der ‚Herrschenden‘ oder ‚des Kapitals‘
dient. Es ist also sinnlos, sich in dieser Beziehung irgendwelche Gedanken zu
machen. Insbesondere angesichts des derzeitigen medialen ‚rinks-gleich-lechts-gleich-Gewalt‘-Diskurses
hat eine solche Einstellung problematische Konsequenzen.
IV Was (nicht) tun?
Zur Erlangung von Hegemoniefähigkeit muss sich linkes Agieren in der gegenwärtigen
Situation mehr denn je bewusst sein, dass seine Interventionen durch den medialen
Diskurs transformiert und gefiltert werden. Es stellt sich also die Frage, wie
die Linke mit dem medialen Diskurs über die Linke umgeht – nicht aufgrund
autistischer Selbstbezogenheit, sondern wegen der Tatsache, dass sich sonst nur
schwer gesellschaftliche Wirksamkeit entfalten lässt. Dabei gilt es, sich
der Tatsache bewusst zu sein, dass es in bürgerlichen Medien bestenfalls
ausnahmsweise Platz für linke Inhalte gibt, dafür aber mannigfache Versuche,
linke Aktionen von ihren Inhalten zu trennen und zu entpolitisieren.
Ein Beispiel hierfür ist die Gleichsetzung ‚rinks gleich lechts gleich
Gewalt‘. Auf diese Weise erfolgt im gesellschaftlichen Diskurs die Kurzschließung
von Rassismus und militantem Antirassismus. Überhaupt besteht ja derzeit
eine Tendenz, die Diskussion gesellschaftlicher Widersprüche durch die Fixierung
auf das Scheinproblem ‚Gewalt‘ zu verdrängen. Am Ende darf dann
der ‚Jugendexperte‘ Heitmeyer lamentieren, die Auflösung der
Familienbindungen, also dass sich die Mütter nicht genügend um ihre
Kinder kümmern, sei für den gegenwärtigen Rassismus verantwortlich.
Für die Linke besteht nun natürlich das Problem, dass sie von den ereignisfixierten
Medien nur während der Randale wahrgenommen wird. Das hat in Teilen der Linken
in der Vergangenheit dazu geführt, dass sie sich, wie oben gezeigt, durchaus
immanent in diesen Diskurs über die Linke einfügten. Einerseits wurde
der Erfolg einer Aktion an der Quantität des Medienechos gemessen, zugleich
erklärte sich niemand für dessen Qualität für zuständig.
Die Linke hat es den Medien dadurch bisher in der Regel einigermaßen leicht
gemacht, die Inhalte ihrer Aktionen unter den Tisch fallen zu lassen. Demgegenüber
wäre es an der Zeit, sich der Funktionsweise der Medien zu entziehen, also
gerade nicht das zu machen, was sie von einem erwarten, ohne dabei in Untätigkeit
zu verfallen oder auf Spektakel zu verzichten. Es geht darum, eine sichtbare Diskrepanz
zwischen der durch die medialen Diskurse und der durch die eigenen Aktionen geschaffenen
Realität zu erzeugen. Das bedeutet zugleich, dass bei allen Aktionen vorab
ins Auge gefasst werden muss, wo wir selbst im medialen Diskurs positioniert sind
und in welches Diskursfeld da eigentlich interveniert wird. Wir müssen häufiger
als bisher zur Kenntnis nehmen, dass sich die gesellschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen mitunter verändern. Beispiel: Wenn vor zwanzig Jahren das
Abfackeln eines Kaufhauses zweifelsohne auf im Sinne der Linken ‚gesicherten‘
symbolischen Terrain vonstatten ging, so ist vor dem Hintergrund von ‚Solingen‘,
‚Mölln‘ und ‚Rostock‘ keineswegs mehr eindeutig,
ob bei einem ähnlichen Vorgehen heutzutage mit ‚brennenden Häusern‘
nicht ganz andere als die gewünschten Assoziationen verknüpft sind.
Eine linke Praxis, die derlei vermeiden will, ist mit der Notwendigkeit konfrontiert,
mit den Symbolen, welche bei einer Aktion verwendet werden und mit den Diskursen,
in denen interveniert wird, sorgfältig umzugehen.
Dabei ist es nutzbringend, sich vor Augen zu halten, dass die medialen Diskurse
keinesfalls einheitlich sind, sondern innere Widersprüche aufweisen. Diese
sind nicht zufällig, sondern Ausdruck gesellschaftlicher Widersprüche.
Und gerade das Neben einander unterschiedlicher und widersprüchlicher Diskurse
ist es, das mögliche Ansatzpunkte für Interventionen von linker Seite
bietet.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Alltagsdiskurse gegen Tatsachen weitgehend
resistent sind. Von daher ist die Wirksamkeit klassisch ‚aufklärerischen‘
Agierens von vorneherein beschränkt. Stattdessen erscheint es erfolgversprechender,
zu versuchen, die HERRschenden (Medien)diskurse mit ‚medialen‘ Mitteln
gegen den Strich zu bürsten. Es geht darum, durch Schaffung von Dissonanzen
auf symbolisch-repräsentativer Ebene reale gesellschaftliche Widersprüche
offensiv zu thematisieren und sichtbar zu machen. Bei diesem Unternehmen können
die bürgerlichen Medien aufgrund der genannten Widersprüche auch in
ihren Diskursen durchaus als Vehikel dienen. Ein gelungenes Beispiel ist in dieser
Hinsicht das autonome Auftreten in Mölln, als der ‚Schwarze Block‘
sich zwischen türkische und kurdische Gruppierungen stellte und auf diese
Weise gewalttätige Auseinandersetzungen während der Protestkundgebungen
unterband. Die Medien nahmen dieses Verhalten verwundert zur Kenntnis.
Eine Möglichkeit wäre, den derzeitigen Diskurs, mit dem alles und jedes
innergesellschaftliche Problem auf die Scheinfrage der ‚Gewalt‘ reduziert
wird, als Ausgangspunkt einer autonomen ‚Keine-Gewalt‘-Aktion zu nehmen.
Dabei könnten mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: Ausgehend
von dem hegemonialen bürgerlichen Diskurs, wie unzureichend Gewalt gesellschaftliche
Probleme lösen kann, wäre es immerhin einen Versuch wert, denselben
in Form seiner Argumentationsfiguren aufzunehmen und nun von unserer Seite um
die fehlenden Dimensionen zu erweitern: Das staatliche ‚Gewaltmonopol‘
nach innen und nach außen, die strukturelle Gewalt der Gesetze und der Staatsbürgerschaft
(Abschiebungen). Ein Nebeneffekt wäre zugleich, den grünen (gewaltfreien)
Liebhabern der ‚freundlichen Zivilgesellschaft‘ eine Breitseite zu
verpassen (wenn wir dabei den wendigen Fritze Kuhn nicht erwischen, trifft es
allemal den Rezzo Schlauch).
Bei entsprechenden Aktionen kann versucht werden, Symbole des herrschenden Diskurses,
beispielsweise mit Methoden der Spaßgurilla, neu zu montieren, zu verfremden
und zu denen zieren. Ziel ist es dabei nicht in erster Linie, ein ‚gutes‘
Presseecho zu erzielen (das ist wohl nur noch mit Lichterketten möglich),
sondern vielmehr, die herrschenden Mediendiskurse zu verunsichern. Gleichzeitig
erscheint es uns angesichts der Tatsache, dass bürgerliche Medien eben nicht
nur lügen (können), nicht unmöglich, durch phantasievollen und
spielerischen Umgang mit verschiedenen Aktionsformen doch noch Inhalte rüberzubringen.
Möglichkeiten und Grenzen solcher Aktionen hat eine Demonstration gegen Bundesinnenminister
Rudolf Seiters am 7. Juni 1993 bei einer CDU-Veranstaltung in Marbach a.N. anschaulich
vor Augen geführt. Zum einen wurde deutlich, dass die großen Zeitungen,
Rundfunk und Fernsehen der Region nicht (Stuttgarter Nachrichten) oder nur auf
Nachrichtenbasis (Stuttgarter Zeitung) berichten, wenn ‚nichts abgeht‘,
sprich wenn keine Randale stattfindet. Einige JournalistInnen waren regelrecht
enttäuscht, dass wir dort nicht jenes Spektakel abgeliefert haben, weswegen
einige offenbar nur gekommen waren („Die picknicken doch nur“ oder
„Des war aber nix“ lauteten die informellen Kommentare).
Nachdem die Demo zwar friedlich, aber zugleich auch phantasievoll verlief, zeigte
sich auch, dass den bürgerlichen MedienmacherInnen unter Umständen kein
Mittel zu blöd ist, um doch noch ihren diskursiven Stiefel zusammenzuschreiben.
So sahen die kleineren lokalen Zeitungen, für die eine Kundgebung mit 500
DemonstrantInnen und einem kleinen ‚Schwarzen Block‘ in jedem Fall
ein Ereignis darstellte, ihre Hauptaufgabe darin, das martialische Polizeiaufgebot
(Drei sichtbare Hundertschaften von ‚Drisch und Drauf‘-Göppingen
und das ganze Arsenal staatlichen Gewaltpotentials etc.) trotz allem zu legitimieren.
Da militante Angriffe ausblieben, versuchten sie zuletzt noch die Sprechchöre
gegen die Brandstifter auf der Regierungsbank und in der CDU zu ‚Gewaltparolen‘
umzulügen.
Einem Teil des Demonstrationszuges gelang, es in die Stadthalle, in der Seiters
reden sollte, zu gelangen. Auch dort unternahmen wir nicht das, was alle von uns
erwarteten. Es wurde versucht, jede gewalttätige Auseinandersetzung mit der
CDU oder den Bullen zu vermeiden. Stattdessen gelang es, zusammen mit den CDUlern
ihre eigene Veranstaltung zu chaotisieren. Das fing mit Zugabe-Rufen für
die zuvor aufspielende Stadtkapelle an und wurde über ‚Rudi Rudi‘-Rufe
und begeisterten Beifall beim Erscheinen von Seiters fortgesetzt. Es waren eben
nicht die politischen Schlachtrufe, die Seiters 20 Minuten am Reden hinderten
(und die auch für die CDU-Heinis wenig Sinn gemacht hätten), sondern
jene inszenierte Begeisterung, die schließlich die CDU-Ordner Stühle
werfen ließ und sie soweit provozierte, dass sie uns am Ende in die Gaskammer
schicken wollten. Den Tumult besorgte schließlich die andere Seite, und
das ärgerte sie am allermeisten. Es war eine der Übermacht der Bullen
geschuldete, angepasste Form des Protests, die gegen das Zentrum der Gesellschaft
intervenierte. Dies halten wir für intelligenter, als uns mit vermummten
Gesichtern eine Abfuhr nach der anderen zu holen.
Milli tanzt aus der Reihe:
Weiter, Weiter, Weiterstadt!
Die Frage künftiger militanter Aktionsformen sollte vor allem unter diesem
Blickwinkel betrachtet werden. Militanz ist ein Mittel und kein Zweck. Auch wenn
es hier nicht darum geht, der Militanz generell ihre Berechtigung abzusprechen:
Sie sollte sich inhaltlich begründen lassen und nicht ausschließlich
gefühlsmäßig motiviert sein. Erst dann wird Militanz politisch.
Militante Aktionsformen können angesichts von rassistischem Terror in der
gegenwärtigen Situation nur in zweierlei Kontext Sinn machen:
- Zum einen bleibt oftmals gar keine andere Wahl, als sich mit Biegen und Brechen
gegen die rechtsextremistischen bzw. neonazistischen Angriffe zu wehren. Es stellt
sich dabei das Problem, dass wir in der Regel nicht das Diskursfeld und die Form
der Auseinandersetzung bestimmen. Angesichts der Brutalisierung der faschistischen
Angriffe bleibt es notwendig, darauf entsprechend reagieren zu können. Aber
selbst in einem solche Fall sollten Aktionen in einer Art und Weise vorbereitet
und durchgeführt werden, dass sie nach außen vermittelbar bleiben,
und es gilt tunlichst zu vermeiden, von unserer Seite einer Militarisierung Vorschub
zu leisten. Wir können die Auseinandersetzung mit den Faschos nicht auf militärischer
Ebene gewinnen.
- Zum anderen bieten unter Umständen gerade militante Aktionsformen angesichts
der Ereignisfixierung bürgerlicher Medien die Möglichkeit, in effizienter
Weise in gesellschaftliche Diskurse einzugreifen. Allerdings muss diese Zielrichtung
dann auch von vorneherein klar sein. Solche Aktionen sind symbolische Mittel der
ideologischen Auseinandersetzung und nicht mehr. Militantes Vorgehen muss mehr
als bisher so organisiert werden, dass es sich nicht ohne Brüche in die herrschenden
Diskurse einordnen lassen.
Ein Beispiel dafür, wie sich mediale Diskurse instrumentalisieren lassen,
wenn die eigene Positionierung darin berücksichtigt wird, hat die jüngste
RAF-Intervention geliefert. Dabei war es durch die Wahl des Objektes der Aktion
möglich, das Ziel eines politischen Kampfes symbolisch zu verdeutlichen.
Darüber hinaus wurde aber infolge der deeskalierenden Durchführung der
Aktion der Mediendiskurs instrumentalisiert. Zum einen mussten BKA und BND öffentlich
zugeben, dass es der RAF auf diese Weise gelungen ist, den Unterschied zwischen
ihrem Vorgehen und dem rechten Terror zu untermauern. Dieser war zu offensichtlich,
als dass er von jenem Pawlowschen Medienreflex übertönt werden konnte,
der bei jeder Aktion, die unter dem Label ‚RAF‘ erscheint, Zeter und
Mordio schreit, der die bundesdeutsche politische Klasse unisono an die Mikrophone
der öffentlichrechtlichen Rundfunk und Fernsehanstalten treten und beschwören
lässt, wie gefährlich und schlimm (Bundesinnenminister R. Seiters damals:
wie viel gefährlicher und schlimmer als der rechte Terror) dieser Linksterrorismus
doch ist.
Dabei haben sie sich diesmal gründlich in die eigene Suppe gespuckt. Nun
mussten sie plötzlich entdecken, wie unzumutbar und inhuman ihr ‚Strafvollzug‘
doch ist. Darüber hinaus ließ Seiters nicht wenige Bürgerlich-Liberale
merken, wie in dieser Gesellschaft die Wertigkeiten verteilt sind: Wenn ein zig
millionenteurer Knast ramponiert wird, ist das allemal viel schlimmer als wenn
Dutzende Flüchtlinge, Menschen mit fremdem Pass und Obdachlose in dieser
Republik totgeschlagen werden. Die RAF hat den Maßstab für künftige
militante Aktionen neu bestimmt. Durch intelligenten Umgang mit medialen Platzierungen
bietet sich für jedeN die Möglichkeit, den Medien zumindest einen diskursiven
Schluckauf zu bereiten.
Die von uns entwickelten Überlegungen und Vorschläge haben einen Abschied
vom Mythos ‚Militanz‘ zur Voraussetzung. Danach führen wir zwar
nicht mehr so häufig direkte Angriffe auf das System aus, allerdings erhalten
wir die Chance, mit größerer Intensität an seinen ideologischen
Grundlagen zu sägen. Und das ist immerhin die Voraussetzung für jegliche
Umwälzung der Verhältnisse. Denn die ‚Kritik der Waffen‘
verkommt ohne die ‚Waffe der Kritik‘ in der Regel zum Rohrkrepierer.
 Medienrandale
I Medienrandale
I
Literaturhinweise
- autonome l.u.p.u.s.-gruppe rhein/main: DOITSCH-Stunde. In: Projektgruppe
Metropolen-(Gedanken) und Revolution (Hg.): Texte zur Patriarchats-, Rassismus-
und Internationalismusdiskussion. Berlin 1991 (Edition ID-Archiv).
- Diedrich Diederichsen: The kids are not alright. Abschied von der Jugendkultur.
In: SPEX Nr. 11/1992.
- Geronimo: Feuer und Flamme. Zur Geschichte und Gegenwart der Autonomen. Berlin
1990 (Edition ID-Archiv).
- Geronimo u.a.: Feuer und Flamme 2. Kritiken, Reflexionen und Anmerkungen
zur Lage der Autonomen, Berlin 1992 (Edition ID-Archiv).
- Stuart Hall: Die Konstruktion von 'Rasse' in den Medien. In: Hall, Stuart:
Ausgewählte Schriften. Ideologie, Kultur, Medien, Neue Rechte, Hamburg 1989
(Argument-Verlag).
- Klaus Schönberger/Claus Köstler: Mystifikation des DOITSCH-Seins.
Vom geringen Nutzen der Historie für die Erklärung und Bekämpfung
des gegenwärtigen Rassismus und Nationalismus. In: Autonomes Zentrum Marbach
(Hg.): Zur Kritik von Nationalismus, Nation, (National-)Staat und nationaler Identität,
Tübingen 1993 (Verlag Martin Jung).
|
 |
 |