 |

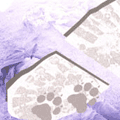

 |
 |
 |
Von der Systemopposition zur Staatspartei
Micha Brumlik  15. Juni
1999 15. Juni
1999
Kommentar zum Grünen Sonderparteitag
Mit der Entscheidung von Bielefeld – unabhängig davon, ob man die dort
verabschiedete Resolution für angemessen hält oder nicht – sind
die Grünen endgültig und unwiderruflich zu einem Teil des Status quo
geworden. Sie haben auch die letzten, vielleicht nur noch ideologischen Reste
von Systemopposition preisgegeben und sich etabliert. In Bielefeld ist in einem
ebenso schrillen wie mitreißenden Ritual lediglich besiegelt worden, was
sich seit mehr als zehn Jahren abzeichnete. Zugleich haben die Grünen damit
ihre Rolle, einen doch noch privilegierten Ort für eine wie auch immer definierte
„Linke“ darzustellen, verloren. So „links“, wie die Grünen
fortan sein werden, kann man sich in CDU, SPD und PDS allemal gerieren.
Mit der Aufgabe der pazifistischen Grundüberzeugungen ist der letzte Wertbezug,
der die einstige grüne Partei auszeichnete, getilgt worden. Zugleich treten
die Grünen von jetzt ab als zweite liberale Partei mit der FDP in Konkurrenz.
Dass in Deutschland zwei liberale Parteien, zwei liberale Strömungen miteinander
konkurrieren, ist historisch gesehen nichts Neues. Die Weimarer Republik kannte
die nationalliberale DVP Gustav Stresemanns und die eher linksbürgerliche
DDP. Auch der Blick zurück ins Revolutionsjahr 1848 verweist auf die spannungsreiche
Koexistenz von eher konservativ gestimmten Nationalliberalen und sozialpolitisch
aufgeschlossenem Freisinn. Auch bei den europäischen Nachbarn spielen ehemals
linksliberale Parteien keine ganz unwichtige Rolle: Man denke nur an die linksbürgerliche
D66 in den Niederlanden sowie die Republikanische Partei oder den Partito Radicale
in Italien.
Gleichwohl stellen sich für die Grünen, als integraler Bestandteil und
Konkurrent im bürgerlichen Lager, eine Reihe von Fragen, die alsbald zu beantworten
sind: Was soll – nachdem der Traum von der kleinsten Volkspartei ausgeträumt
und der Osten endgültig verloren ist – die soziale Basis der Partei
sein? Wie lässt sich diese soziale Basis programmatisch ansprechen, wenn
schon nicht binden? Demoskopische Untersuchungen lassen derzeit keinen anderen
Schluss zu, als dass es sich bei der Wählerbasis der Grünen um eine
Jahrgangskohorte mehrheitlich vierzig- bis fünfzigjähriger Angestellter,
Beamter und Selbständiger mit überdurchschnittlichem Bildungsgrad und
vergleichsweise gesicherter sozialer Lage handelt. Es ist daher kaum verfehlt,
von einer Partei des – durch die Reform der sechziger Jahre begünstigten
– neuen Bildungsbürgertums zu sprechen. Diese Gruppe zeigt sich, insofern
sie bildungsbürgerlich ist, universalistischen, postmaterialistischen Werten
gegenüber durchaus aufgeschlossen, weiß aber als bildungsbürgerliche
Schicht den Besitz von symbolischem, sozialem und finanziellem Kapital durchaus
zu schätzen. Damit, auch darüber sind sich die Demoskopen einig, scheiden
die Grünen als Partei der sozialen, der umverteilenden Gerechtigkeit aus.
Dieser Umstand bewirkt zugleich eine strukturelle Schwäche am Wählermarkt:
Nach wie vor verdienen die meisten Menschen in diesem Lande ihr Geld – sofern
sie keine staatlichen Transferabkommen beziehen – als Arbeitnehmer. Für
die Sorgen und Bedürfnisse dieser Gruppe haben die Grünen, deren Wirtschaftspolitik
vor allem auf den Mittelstand zielt, kein Sensorium. Kann eine Partei, die weder
– wie die FDP – die Interessen der wirtschaftlich Mächtigen artikuliert
noch – wie SPD und CDU/CSU – Arbeitnehmerinteressen verschiedenster
Milieus und Segmente bündelt, langfristig bei Wahlen bestehen? Diese Sorgen
– die relative Überalterung – macht sich die Partei selbst, sitzt
dabei aber nur ihrem eigenen Jugendlichkeitswahn auf. An und für sich müsste
eine Verankerung bei älteren Jahrgängen in einer ohnehin alternden Gesellschaft
kein Nachteil sein. Die langfristigen Probleme liegen daher nicht bei einer altersmäßigen
Verengung, sondern im zu schmalen bildungsbürgerlichen Sockel. Die bisher
gehandelten Vorschläge, die Grünen zu einer die Probleme der Lebensformen
aufgreifenden „liberalen Familienpartei“ umzumodeln, könnten
– sofern die Blindheit auf dem Arbeitnehmerauge weichen würde –
diese Basis verbreitern.
Wirklich durchschlagend und Erfolg versprechend aber wäre diese Strategie
nur, wenn sie mit einer aggressiven Umwandlung der sozialpolitisch geordneten
Generationenverhältnisse verbunden wäre. Das aber hieße wiederum
nichts anderes, als eine der FDP nahe, sozialstaatskritische Lösung der Altersversorgungsfrage
zu propagieren – eine Lösung, die nicht nur einer überzeugenderen
Konkurrenz konfrontiert wäre, sondern auch den postmaterialistischen Gerechtigkeitsvorstellungen
der älteren Parteibasis widersprechen dürfte. Ob der demnächst
anstehende Versuch, unter dem im Feld der Ressourcenwirtschaft sinnvollen Begriff
der „Nachhaltigkeit“ neben „Freiheit“, „Gleichheit“
und „Solidarität“ einen weiteren Grundwert in der politischen
Arena zu etablieren, gelingt, darf bezweifelt werden. Vielmehr ist zu argwöhnen,
dass dieser Begriff einer konservativen Naturalisierung des politischen Diskurses
und damit der Ideologiebildung Vorschub leisten würde.
Als wahrscheinlichster, allemal riskanter Ausweg bleibt daher eine faktische Umgründung
der ehemals systemoppositionellen Partei zu einer Staatspartei. Anders als die
totalitären Organisationen in Staaten mit bürokratischer Herrschaft
verkörpern Staatsparteien in demokratischen Systemen so etwas wie das „Interesse
des Staates an sich selbst“ (Claus Offe). Für Staatsparteien dieser
Art ist es typisch, dass sich ein überproportional hoher Anteil ihrer Mitglieder
in Regierungs-, Parlaments-, Verwaltungs- und Parteifunktionen befindet und dort
bei Strafe des ökonomischen Existenzverlusts ihr Leben fristet. Die immer
wieder beklagte, zu dünne Personaldecke belegt das deutlich. Die Ideologie
von Staatsparteien, deren Mitglieder zwar durchaus in der Gesellschaft, aber eben
nicht in gesellschaftlich gewichtigen Großgruppen, verankert sind, wird
zwingend das vermeintliche Allgemeine – etwa die „Nachhaltigkeit“
– zum Mittelpunkt ihrer Programmatik erheben. Das prädestiniert die
Grünen von ihrer realen Existenz her dazu, jene Rolle zu übernehmen,
die ihnen die interessierte Öffentliche Meinung zuweist: die einer posttraditionalen
Modernisierungspartei, die kaum Rücksichten zu nehmen hat. Da es jedoch im
gesellschaftlichen Konfliktfeld keine wert- und interessenfreie „Modernisierung“,
die zu aller Vorteil wirkt, geben kann, droht hier neben der „Nachhaltigkeitsfalle“
ein zweiter Fall von Ideologisierung. |
 |
 |